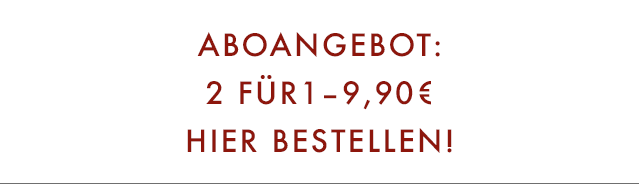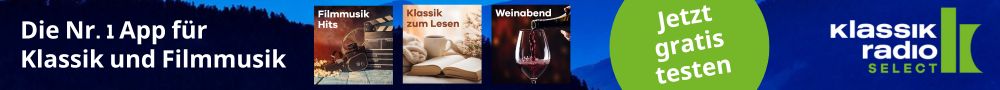Drei Fragen an GeoGuide Christian Suter – geologisches Wissen zum Mitnehmen für jede Bergtour
Herr Suter, was hat es mit dem „Afrika in den Alpen“ auf sich?
Viele wissen nicht, dass sie beim Wandern durch die Alpen manchmal auf einem anderen Kontinent unterwegs sind – zumindest geologisch. Vor rund 100 Millionen Jahren begann sich die Afrikanische Platte nordwärts zu schieben und kollidierte mit der Europäischen. Dabei wurde Gestein, das einst am Meeresboden lagerte, über jüngere europäische Schichten geschoben. In der Tektonikarena Sardona sieht man das besonders deutlich: Dort liegt 250 Millionen Jahre altes afrikanisches Gestein oben – statt unten, wie es eigentlich der natürlichen Schichtung entspricht. Das ist kein Einzelfall: Auch das berühmte Matterhorn trägt an seiner Spitze Gestein afrikanischen Ursprungs. Wer also beim Wandern überlegt, was unter seinen Füßen liegt, entdeckt vielleicht ein Stück Afrika – mitten in den Alpen.
Warum finden wir in den Alpen auf über 2000 Metern Höhe Muscheln und Korallen?
Weil die Alpen früher Meeresboden waren. Im Tethysmeer, das einst Afrika von Europa trennte, lagerten sich über Jahrmillionen Sedimente ab – darunter auch Kalkschalen von Muscheln, Korallen und anderen Meeresbewohnern. Diese bildeten später mächtige Kalkschichten. Durch die Auffaltung der Alpen – ein Prozess, der vor etwa 40 Millionen Jahren einsetzte – wurden diese Gesteine kilometerweit emporgehoben. An vielen Stellen in den Alpen, etwa auf dem Segnesboden bei Flims oder in den Nördlichen Kalkalpen, lassen sich diese uralten Spuren des Meeres noch erkennen. Fossilien auf 2000 Metern Höhe sind also keine Seltenheit – sondern ein Hinweis auf eine Zeit, als hier noch Wellen statt Wanderer unterwegs waren.
Was sagen uns die gestapelten Gesteinsschichten am Wegrand über die Entstehung der Alpen?
Die Schichten in einer Felswand sind wie Seiten in einem Buch – nur viel älter. Meist liegen sie waagrecht, doch in den Alpen wurden sie durch tektonische Kräfte gefaltet, gestaucht und übereinandergeschoben. Deshalb stehen manche Berge heute tatsächlich „auf dem Kopf“. Besonders schön lässt sich das an der sogenannten Glarner Hauptüberschiebung erkennen: Dort liegt uraltes Gestein über deutlich jüngerem. In Flims-Laax ist dieser Prozess besonders gut sichtbar – aber das Prinzip gilt für viele Alpenregionen. Wer unterwegs einen Kontrast zwischen rötlichem Urgestein und hellem Kalkstein erkennt, sieht womöglich eine tektonische Narbe – Zeugnis eines geologischen Kraftakts, der bis heute Berge bewegt.



Tschingelhörner mit Martinsloch: Durch das Naturfenster zieht sich die Glarner Hauptüberschiebung, der geologische Schnitt im Berg. © Fotos: Gaudenz Danuser
– 1 GeoGuide Christian Suter: Praxisnah und kenntnisreich erklärt er bei seinen Touren Plattenwanderung und Erdgeschichte. – 2 Geo Guide Tour mit Blick auf bunte Gesteinsformationen und alpine Flora. – 3 Tschingelhörner mit Martinsloch: Durch das Naturfenster zieht sich die Glarner Hauptüberschiebung, der geologische Schnitt im Berg. // © Fotos: Flims LAAX/Thomas Kessler Visuals, Philipp Ruggli, Gaudenz Danuser
GeoGuide-Touren
Geführte Bergsturz-Tour Rheinschlucht. Mo–Fr, ganzjährig. 2½–3 Std./8 km, Flims Waldhaus–Crestasee. CHF 80 p. P. (ab 4 Personen). Anfrage an Christian Suter unter suter-christian@gmx.ch
GeoGuide-Führung Segnesboden
Übersicht unter unesco-sardona.ch